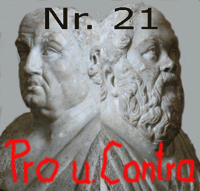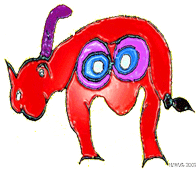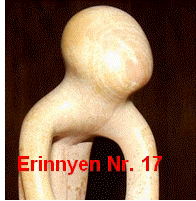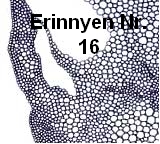Abbonieren Sie unseren:
Holen Sie sich die neuesten Headlines auf ihren Bildschirm:
![]()
Zum Kommentar über den Prager Frühling
Drucktext von Erfahrungsbericht und Kommentar
9.8.2008
Bodo Gaßmann
Mein 1968
Erfahrungen im Prager Frühling
In Jahre 1967/68 studierte ich in Leipzig Geografie und Mathematik, zwei Fächer, die ich als Jugendlicher mochte, nun mit 21 Jahren interessierte sie mich kaum noch. Ich las auch lieber Bücher, die mich weiter brachten in meiner intellektuellen Entwicklung, als die Physik des Regentropfens in seiner Wirkung auf einen Erdkrümel nachzuvollziehen, die von einem autoritären Professor verkündet wurde und von uns Studenten gelernt werden musste. Es ging an dieser Uni alles sehr steif zu, der Assistent machte einen neunzig-Grad-Bückling vor dem Herrn Professor und ich dachte in einer Operette zu sein, die im 19. Jahrhundert in der K. und K. - Monarchie spielt. Von einer Atmosphäre, die im berühmten Hörsaal 40 herrschte, in der Ernst Bloch und Hans Meyer lehrten, war für mich jedenfalls nichts mehr zu spüren.
Bloch war 1961 und Meyer 1963 in den Westen gegangen, ich hatte Letzteren also um vier Jahre verpasst. 1973, als ich dann in Hannover meine Neigungsfächer Deutsch und Geschichte studierte (später kam noch Philosophie hinzu), war Hans Meyer auch gerade wieder gegangen – diesmal nach Tübingen, wo auch Bloch noch lehrte. So kannte ich die beiden allein aus ihren Büchern.
Die fehlerhafte Linie der Führung hat diese Partei aus einer politischen Partei und einem idealistischen Verband in eine Machtorganisation verwandelt, die eine gewaltige Anziehungskraft auf herrschsüchtige Egoisten ausübte, auf skrupellose Feiglinge und Leute mit schlechtem Gewissen. (…) Viele Kommunisten haben versucht, gegen diesen Verfall anzukämpfen, aber es ist ihnen nicht gelungen, auch nur ein wenig davon zu verhindern, was dann Wirklichkeit geworden ist.(1)
Eigenes Foto
Das Autor ein Jahr vor seiner Immatrikulation.
Da ich dank meiner Westtante Nylonhemden und von mir aus längere Haare und lange Koteletten trug, wurde ich auch einmal vor ein FDJ-Gremium geladen, wo man mich zur Rede stellte. Als Hörer von Beatmusik und Jazz gingen mir diese Vorhaltungen am Arsch vorbei, ich habe ihre Argumente nicht begriffen. Es ging wohl nur darum, den äußerlich Unangepassten zum Kuschen zu bringen. Während im Westen Deutschlands die langhaarigen Studenten auf die Straße gingen, wir im Osten zumindest ihren Lebensstil nachahmten – gegen den penetranten Widerstand der Parteibürokraten -, faszinierte uns immer mehr eine Entwicklung, die 1967 in der ČSSR sich manifestierte, im „Prager Frühling“ 1968 mündete und schließlich mit dem Einmarsch der sowjetischen Armee endete.
Anfang Januar 1968 kam es auf der Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei zu einer Auseinandersetzung der progressiven und konservativen Kräfte, die den Beginn einschneidender gesellschaftlicher Wandlungen bedeutete.(2)
Der Prager Frühling (…) ist die Bezeichnung für die Bemühungen der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei unter Alexander Dubček im Frühjahr 1968, ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchzusetzen, sowie vor allem die Beeinflussung und Verstärkung dieser Reformbemühungen durch eine sich entwickelnde kritische Öffentlichkeit. (…)
Die Bezeichnung „Prager Frühling“ leitet sich vom gleichnamigen Musikfestival ab. (3)
Die ersten Informationen über die Veränderungen in der ČSSR („Tschechoslowakische Sozialistische Republik“) bekam ich aus dem „Neuen Deutschland“ und anderen Presseerzeugnissen, die zunächst die Resolutionen der KPČ durchaus dokumentierten. Später wurden die Artikel und Kommentare immer kritischer und schließlich polemisch und verfälschend. Aus dem Gegenstand der Kritik und zwischen den Zeilen, aber auch aus dem Westrundfunk, der in Leipzig zu empfangen war, konnte ich erkennen, was die Reformer wollten – und das, wie z. B. die Abschaffung der Zensur, begeisterte mich.
Das Präsidium des ZK der KPČ beschloss, bei den Beratungen des ZK eine solche Atmosphäre zu schaffen, die die Freiheit der Kritik und des schöpferischen Wettstreits der Anschauungen, die Beurteilung von verschiedenen Varianten und Standpunkten ermöglichen wird.(4)
In der Schule wurde ich im Sinne der DDR-Ideologie und ihrer Schwankungen erzogen, zu Hause eher antikommunistisch beeinflusst (meines Großvaters Devisen waren: „Kompanie ist Lumperie“, „die DDR übt genau so ein Abgabezwang auf uns Bauern aus wie die Nazis“, „1959 wurde uns das Vieh, die Maschinen und das Land weggenommen“ (als wir in die Genossenschaft mussten)). Vor allem durch den Dirigismus bei meiner Berufswahl war ich eher abgeneigt von diesem Staat (da meine Eltern aus der Landwirtschaft kamen, musste ich einen landwirtschaftlichen Beruf erlernen) – doch in den Jahren 1966 bis 1968 gab es doch auch Raum für Hoffnungen auf einen Sozialismus, der nicht administrativ sein sollte, in dem die Menschen nicht belogen und gegängelt wurden. Zögernde Sympathien für den DDR-Staat keimten auf. Die Literatur bestärkte mich darin, etwa Christa Wolfs „Geteilter Himmel“ oder Eric Neutsch „Spur der Steine“. Im Staatsbürgerkunde-Unterricht in der Abendschule konnte man über die negativen Erscheinungen zumindest ansatzweise diskutieren. In meinem Betrieb hatte ich ein langes Gespräch über das Rätesystem, von dem ich seine Prinzipien aus dem Geschichtsunterricht kannte, mit einem aufgeschlossenen Kaderleiter.
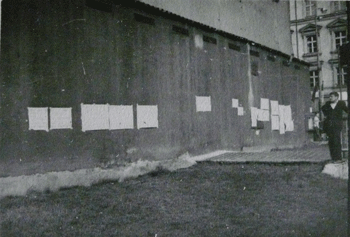 Eigenes Foto
Eigenes Foto
Interessant an diesem Bild ist das, was man nicht sieht. Ich vermute, dass die Entwickler dieses Fotos in Leipzig bewusst die Schrift auf den Plakaten wegretuschiert haben.
Außerdem ist die Ablehnung Dubčeks, über die Führungsrolle der Partei zu diskutieren, im höchsten Maße unreal. Wenn die führenden Stellen es verbieten, die Frage in ihrer Gesamtheit grundsätzlich zu stellen, so wird die Frage in jeglichem Gespräch über jedwede konkrete Maßnahme, an die Partei oder Staat herangegangen sind, implizit und demnach in deformierter Gestalt stets von neuem auftauchen. Das ist gewöhnlich das peinlichste Ergebnis von Verhältnissen, die sich auf die Unterdrückung der grundlegenden politischen Probleme gründen. (5)
Bekannte von mir, auch Studenten an der Leipziger Universität, fuhren im Frühjahr nach Prag und brachten Broschüren und einen „Spiegel“ mit, den man dort frei kaufen konnte. Darin las ich das noch heute berühmte Interview mit Rudi Dutschke, das ich mit Begeisterung und Skepsis studierte. Begeisterung, weil darin eine Vorstellung von Sozialismus angedeutet wurde, die auch mein erwachendes sozialistisches Bewusstsein reizte, mit Skepsis, weil das Vokabular mich stark an das „Neue Deutschland“ erinnerte. (Erst später in der U-Haft in Leipzig las ich den ersten Band des „Kapitals“ von Marx und hatte meine profane Erleuchtung. Die Aufzeichnungen besitze ich noch, sie sind rein rezeptiv (schon wegen etwaiger Filzung), dennoch bin ich durch dieses Buch endgültig Sozialist geworden. Als ehemaliger Produktionsarbeiter konnte ich das kritische Potenzial dieser Analyse des Kapitalismus auch auf meine DDR-Lage beziehen: Vor allem die Erkenntnis, dass ich genauso ausgebeutet wurde wie meine Kollegen im Kapitalismus, solange ich nicht politisch über das erarbeitete Mehrprodukt mitbestimmen konnte, beeindruckte mich stark.)
Keine Organisation, auch keine kommunistische, gehörte in Wirklichkeit ihren Mitgliedern. Die Hauptschuld und der allergrößte Betrug dieser Herrscher ist es, daß sie ihren Willen für den Willen der Arbeiterschaft ausgegeben haben. (6)
Zum ersten Mal las ich auch originale Schriften von Autoren des „Prager Frühlings“, die in deutscher Sprache dort zu haben waren. Ich musste unbedingt dorthin, mir selbst eine Vorstellung von dem neuen Kurs eines Dubček verschaffen. Die Vorbereitungen waren nicht einfach. Zwar war die Visapflicht zwischen der DDR und der ČSSR abgeschafft, aber man brauchte dennoch eine Art Genehmigung. Ich war nervös, bis ich endlich Anfang August 1968 meine Ausreisegenehmigung bekam. Den nächsten Tag saß ich auf meinem Motorrad (250er MZ) und fuhr über die Landstraßen von Leipzig über Brno nach Bratislava.
Die erste Wegstrecke von Leipzig nach Brno dauerte 12 Stunden und ich fiel wie gerädert in mein angemietetes Zelt, mein eigenes aufzubauen, hatte ich keine Lust mehr. Wegen der Anspannung der langen Fahrt konnte ich kaum schlafen. Doch am nächsten Morgen nach Bratislava ging alles schneller und leichter. Der Umweg über Bratislava nach Prag hatte Gründe, die zu einer anderen Geschichte gehören. Es war hauptsächlich die Grenze zu Österreich, die ich erkunden wollte. Fast eine halbe Stunde fuhr ich am Grenzzaun entlang. Hier die Straße, auf der ich mit meinem Motorrad fuhr, rechts von mir ein einfacher Drahtzaun, der allerdings oben mit einem halben Meter flachliegenden Draht und mit Sensoren gesichert war. Dann kam die Moravě, ein zehn Meter breiter Fluss, und schließlich das österreichische Ufer. Alle zweihundert bis fünfhundert Meter kam ein Wachturm, auf dem meist ein Grenzpolizist saß und sich langweilte. Es schien mir nicht schwierig evtl. bei Nebel nach Österreich zu gelangen. Aber es war kein Nebel, die Angst erschossen zu werden und der neue Kurs in Prag, der Hoffnung machte für den ganzen Ostblock, hielten mich davon ab, es zu versuchen. Mein Plan bestand auch nur darin, nach solch einer Möglichkeit der Flucht Ausschau zu halten.
(Mai 1968): Nach der Orientierungsforschung der öffentlichen Meinung erachteten zwei Drittel von 1476 befragen Bürgern den jetzigen Erneuerungsprozess in der ČSSR als eine dauernde Änderung, etwa ein Fünftel weiss nicht, ob es sich um dauernde oder vorübergehende Änderungen handelt, ein Siebentel schreibt ihm vorübergehende Bedeutung zu. 75 % Tschechen und 77 % Slowaken erwarten, dass das gegenwärtige Geschehen zur Stärkung des Sozialismus beiträgt. Befürchtungen um seine Schwächung sprachen 7 % in Böhmen und 5 % in der Slowakei aus. Eine Stärkung der Demokratie sehen 88 %, eine Schwächung 1 %, „ich weiß nicht“ antworteten 11 %. (7)
Eigenes Foto
Der neue Kurs der Partei wird diskutiert.
Während meiner Motorradreise von Brno nach Bratislava nahm ich einen Studenten mit. Er lud mich zu seiner Familie ein und bummelte mit mir durch Bratislava. Leider konnte ich kein Tschechisch, er kein Deutsch und unser bisschen Schulenglisch (eine AG hatte ich besucht) reichte nicht aus, um über qualifizierte Themen zu reden. Dennoch bekam ich einen ersten Eindruck von dem neuen Kurs: Das Überraschende - nicht alle waren damit einverstanden, obwohl allgemein große Euphorie bei den Gesprächen herrschte, wenn man auf Dubček zu sprechen kam. Eine alte Dame, die noch die Vorkriegszeit erlebt haben musste und ihren Schmuck und ihrer Kleidung nach sehr wohlhabend aussah, schimpfte auf den neuen KPC-Chef und die anderen Reformer, sie seien auch bloß Kommunisten, würden genauso von oben administrieren – auch wenn sie einen liberaleren Kurs einschlügen, erst wenn freie Parteien sich der Wahl stellen würden, könnte sich prinzipiell etwas ändern. So jedenfalls ist mir die Meinung der alten Dame, die gut Deutsch sprach, in Erinnerung.
Die politische Machtstruktur in Stadt und Land blieb von den letzten Veränderungen fast unangetastet. Eine Leserin aus einer Kreisstadt in der Nähe von Prag konnte deshalb mit Recht schreiben: „Wenn wir nicht die Presse, Rundfunk und Fernsehen hätten, würde hier überhaupt niemand wissen, daß irgendwo ein Reformprozeß im Gange ist.“(8)
In Prag habe ich solch eine Meinung wie die der Dame aus Bratislava kaum gehört, obwohl ich tagsüber von einer Diskussionsgruppe zur anderen wanderte, meist bloß zuhörte, soweit sie deutschsprachig waren – bis mir meine Füße weh taten oder ich Gulasch mit Knödeln essen ging. Man schätzte wohl die Möglichkeit der Reformer realistischer ein.
 Eigenes Foto
Eigenes Foto
Überall in der Prager Innenstadt gab es solche Gruppen, die schnell eigene Ideen entwickelten, damit die Reformen nicht stagnieren.
Es waren alle Richtungen vertreten: Liberale, Konservative, Leute aus der westdeutschen Studentenbewegung, deutschsprachige Prager Bürger, Kommunisten, Sozialisten, Studenten aus der DDR und der BRD, junge Tschechen, Prager Intellektuelle. Sie standen auf dem Wenzelsplatz bis zum Altstädter Ring, unter dem Reiterstandbild des Heiligen Wenzel bis zum Denkmal von Jan Hus. An einigen Wänden hingen Plakate über den neuen Kurs der Partei, aber auch Wandzeitungen, die weitergehende Reformen verlangten. Es war für mich eine Lust, diesen freien Diskussionen zu lauschen. Selbst noch ungefestigt, ein Sucher, der zwar weiß, was er nicht will, aber nicht weiß, was er will. So etwas hatte ich bisher nur ansatzweise zum Jugendtreffen 1964 in Ostberlin erlebt, als Westberliner Studenten eingeladen waren, die nicht weit vom Brandenburger Tor in der Straße unter den Linden mit DDR-Jugendfunktionären und zufälligen Anwesenden über die Missstände in der DDR, den Sozialismus und den kapitalistischen Westen diskutierten.
Hier in Prag waren diese Gespräche aber nicht organisiert oder von Funktionären mehr oder weniger dominiert, auch wenn sie sich kritischen Fragen stellen mussten, sondern waren entsprechend dem Diskussionsbedarf der Bevölkerung und der Besucher aus den Ausland völlig frei. Bei den vielen Themen, die angeschnitten wurden, den Reden über die Probleme des Sozialismus damals, die ich erst während meines Geschichtsstudiums in Hannover wirklich geistig durchdrang, ist mir doch eine Aussage eines Schweizers in Erinnerung geblieben, deren Tendenz ich bis heute behalten habe und die ich mir zu eigen gemacht habe.
Vom Süden kommt der Fluß herbeigeströmt. Sein Name ist Vltava – die Moldau. Er kommt aus der Ferne, aus der Tiefe der böhmischen Landschaft, und auf den Zauberspiegeln seiner Wellen bringt er der Stadt Prag ihre Lieblichkeit. Prag fällt in seine tausenden Spiegel wie Lichtstrahlen in ein Objektiv, und der Fluß nimmt das Bild der Stadt mit in das geheimnisvolle Strömen der Umarmung. Unter dem Felsen von Mělník, wo Moldau und Elbe sich vermählen, übermittelt sie Prags Bild den meerwärts fließenden Gewässern.(9)
Er sagte, im kapitalistischen Westeuropa haben wir eine politische Demokratie, aber der Bereich der Wirtschaft wird autoritär von den Eignern der Produktionsmitte bestimmt, denen sich die Politik letztlich anpassen muss. Im Ostblock sind die Produktionsmittel zwar vergesellschaftet, aber über die Zwecke der Produktion und das politische Leben bestimmt allein die Parteibürokratie bzw. Ihre Führung. Das Neue, das Revolutionäre, das Alternative des Prager Frühlings besteht nun darin – so der Schweizer -, dass der Weg zur Demokratisierung des Landes beide Bereiche, die Ökonomie und die Politik, unter die Kontrolle der Bevölkerung stellt, erst dadurch sind die Produktionsmittel wirklich vergesellschaftet und die Bevölkerung kann ihre Interessen politisch artikulieren und durchsetzen.
Der Sozialismus ist eine menschliche Gemeinschaft, die nur mit der Unterstützung der Mehrheit der Gesellschaft erfolgreich leben kann und nicht gegen ihren Willen. Von dieser Erkenntnis gehen auch die demokratischen Reformen des tschechoslowakischen Modells des Sozialismus aus. (…) Die Kardinalfrage ist das Problem der Kontrolle der politischen Macht im Sozialismus. (10)
Dieser Gedanke müsste selbstverständlich noch konkretisiert werden. Es wird in dieser Kürze abstrahiert von dem Einfluss des Westens mit seinen Konsumlockungen, ein Konsum, der doch nur immer einem Teil der Bevölkerung möglich ist. Es wird abstrahiert von der weltpolitischen Lage, der Macht der Parteibürokratie im in den anderen staatsmonopolistischen Ländern des Ostblocks. Auch der viel diskutierte „Dritte Weg“ zwischen Markt- und Planwirtschaft, wie ihn Ota Šick durchsetzen wollte, hat seine Aporien (siehe Kommentar). Aber als Zielvorstellung hat dies Formel von der Demokratisierung der Politik auf der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel (im Gegensatz zu bloß verstaatlichten) durchaus ihre Berechtigung, weil nur so eine vernünftige Gestaltung der Gesellschaft möglich ist.
Der entscheidende Einwand gegen diese Zielsetzung der Reformer kam allerdings nicht aus dem Westen, wo man der Schwerkraft der ökonomischen Sachzwänge sich anvertraute, wo man bei so einem Kurs der ČSSR hoffte, dass sie aus dem Osten ausbrechen und in den Schoß der freien Welt des Marktes zurückkehren würde; er kam auch nicht durch die Praxis, an der sich die neuen Ideen zu bewähren hatten – er kam aus der Parteibürokratie des sowjetischen Lagers, die, weil sie keine stichhaltigen Argumente hatte, auf die Panzer verfiel.
 Propagandafoto
Propagandafoto
Alexander Dubček
Es gab mehrere Treffen, auf denen Dubček und seine Reformer bearbeitet wurden, es gab faule Kompromiss-Papiere und es gab Besuche von anderen Staatsführern. Tito war da, in dessen Land eine halbherzige Rätedemokratie praktiziert wurde, die aber einer Autoritätsfigur bedurfte, um das heterogene Jugoslawien zusammen zu halten. Er stand voll hinter den Reformern, gehörte aber nicht zum Ostblock, sondern zu den sogenannten blockfreien Staaten. Und es kam Ceaucesku, der Führer Rumäniens, der damals noch nicht der schäbige Diktator war, sondern durchaus Sympathien in der Bevölkerung genoss, weil er einen freieren Kurs gegenüber der Sowjetunion verfolgte, ohne allerdings in seinem Land solche Reformen wie in der ČSSR einzuschlagen.
Teure Genossen!
Im Namen der Zentralkomitees der kommunistischen Arbeiterparteien Bulgarien, Ungarns, der DDR, Polens und der Sowjetunion wenden wir uns an Sie mit diesem Brief, der diktiert ist von aufrichtiger Freundschaft (…) und von Sorge um unsere gemeinsamen Angelegenheiten (…) Ihnen ist bekannt, daß die Bruderparteien die Beschlüsse des Januar-Plenums des ZK der KPC mit Verständnis aufgenommen haben in der Überzeugung, daß Ihre Partei die Hebel der Macht fest in ihren Händen halten, den ganzen Prozeß im Interesse des Sozialismus lenken und der antikommunistischen Reaktion nicht gestatten wird, diesen Prozeß für die eigenen Zwecke zu mißbrauchen. (…) Leider nahmen die Ereignisse einen anderen Verlauf. Die Kräfte der Reaktion nutzen die Schwächung der Führung des Landes durch die Partei aus, mißbrauchen demagogisch die Losung der „Demokratisierung“(…) Die in der letzten Zeit außerhalb der Nationalen Front entstandenen politischen Organisationen und Klubs sind im Grunde genommen zu Stäben der Kräfte der Reaktion geworden. (…) Die antisozialistischen und revisionistischen Kräfte haben die Presse, den Rundfunk und das Fernsehen an sich gerissen und sie zu einem Sprachrohr der Angriffe gegen die Kommunistische Partei, der Desorientierung der Arbeiterklasse und aller Werktätigen, einer zügellosen antisozialistischen Demagogie (…) gemacht. (…) Deshalb meinen wir, daß die entschiedene Zurückweisung der Angriffe der antikommunistischen Kräfte und die entschlossene Verteidigung der sozialistischen Ordnung in der Tschechoslowakei nicht nur Ihre, sondern auch unsere Aufgabe ist. (11)
![]()
Hier können Sie Ihren Kommentar abgeben,
Kritik üben oder
Kontakt mit uns aufnehmen.
![]()
Empfehlungen zu unserem Internetauftritt
Zu den letzten Artikeln unseres Webprojektes im Überblick:
Unsere Audiobeiträge:
Alle Bücher des Vereins und die Zeitschrift "Erinnyen" gibt es in unserem Online-Buchladen:
Die letzten Ausgaben der "Erinnyen" im Internet zum kostenlosen Herunterladen:
© Copyright:
Alle Rechte liegen beim Verein zur Förderung des dialektischen Denkens, e.V. Die Inhalte der Website können frei verwendet werden, wenn nichts anderes vermerkt wird, soweit sie nicht verfälscht dargestellt werden und ein Quellenvermerk angebracht wird. Ausnahmen bilden als wissenschaftlich gekennzeichnete und namentlich genannte Beiträge. Hier liegen die Rechte allein bei den Autoren.
Letzte Aktualisierung: 02.09.2010